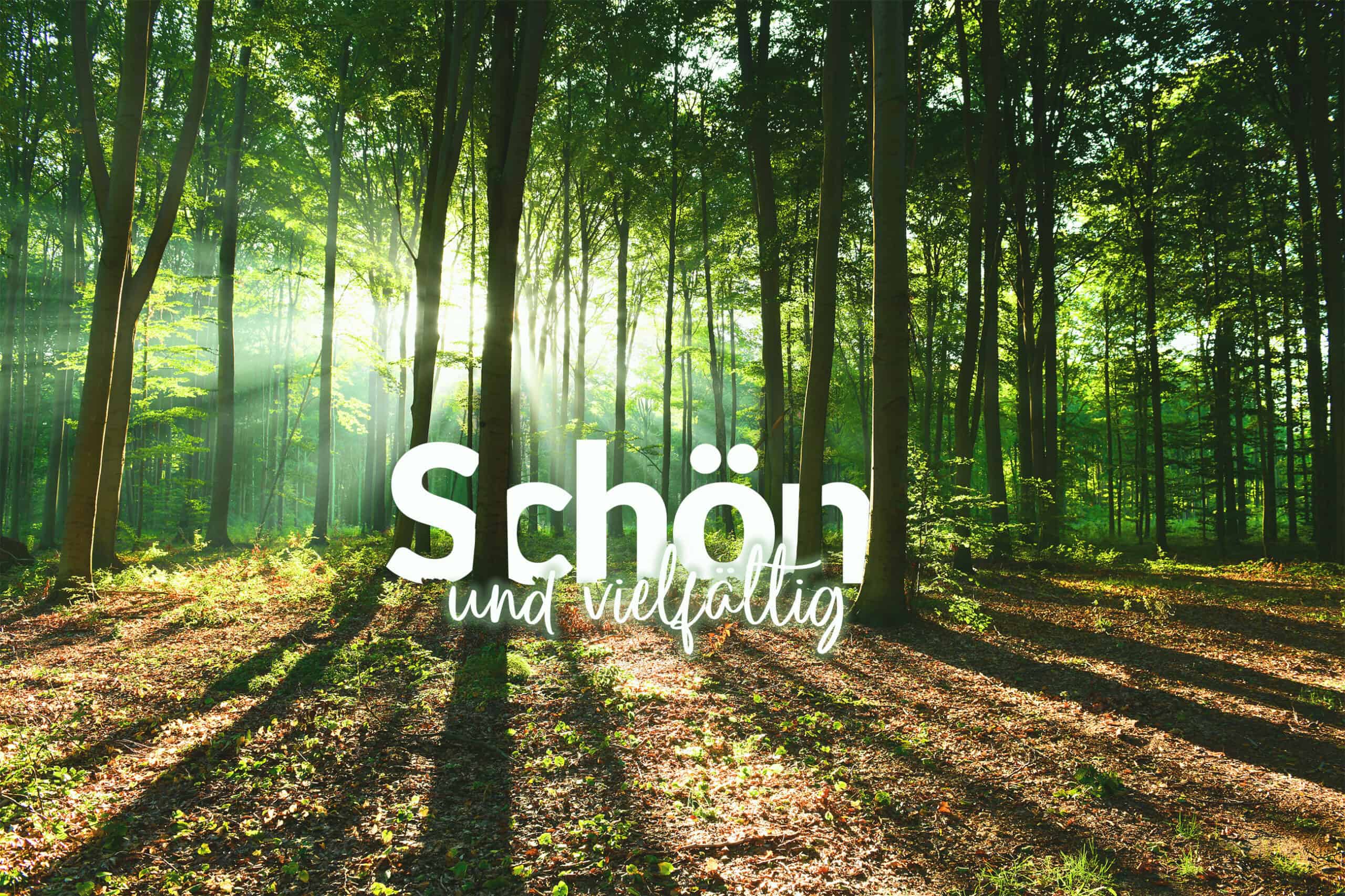© 2024 Adobe Stock, Nikki
Die Bedeutung der Waldbewirtschaftung für den Artenschutz von Gefäßpflanzen
Zusammenfassung einer Studie von DI Johannes Leeb
Der vielschichtig aufgebaute Wald beherbergt eine Vielzahl an Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen. Durch die unterschiedlichen Bedingungen können auch Lebensräume für seltene Arten geschaffen werden. Dem Vorkommen seltener Arten wird beim Artenschutz eine große Bedeutung beigemessen.
Eine Arbeit zum Artenschutz in Deutschland untersuchte das Vorkommen und die Verteilung von Gefäßpflanzen aus verschiedenen Naturschutzkategorien im Wald und im Offenland. Dabei wurden die Schutzkategorien von geschützten und gefährdeten Arten sowie Arten, für welche der Staat die Verantwortung für den Fortbestand trägt, betrachtet.
Vielfalt der Gefäßpflanzen ist im Wald wenig betroffen
Als Datengrundlage wurde die Rote Liste aus den Jahren 1996 und 2018 verwendet. Entgegen dem Trend der gestiegenen Anzahl an ausgestorbenen Gefäßpflanzenarten im Offenland, wurde im Wald sogar eine im Jahr 1996 als ausgestorben ausgewiesene Pflanzenart bis zum Jahr 2018 wiederentdeckt.
Die Anzahl der im Offenland vorkommenden Pflanzenarten, die den genannten Schutzkategorien zugeordnet werden können, war deutlich größer als jene der im Wald vorkommenden Arten. Insgesamt wurden nur zwei eigentlich im Wald vorkommende Pflanzenarten als sowohl geschützt als auch gefährdet eingestuft. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Rückgang der Pflanzenarten hauptsächlich im Offenland und nicht im Wald stattfindet.
Mykorrhiza ist für einige Pflanzen das Lebenselixier
Ein Teil der im Wald vorkommenden und den Schutzkategorien zuordenbaren Gefäßpflanzen sind von bestimmten Mykorrhiza-Pilzarten abhängig. Diese Pilze sind häufig wiederum mit einem breiten Spektrum verschiedener Baumarten verbunden und versorgen die krautigen Pflanzen am schattigen Waldboden mit Kohlenstoff, den diese selbst nicht in ausreichender Menge produzieren können. Das deutet darauf hin, dass das Vorkommen vieler verschiedener Baumarten, die in Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen leben, auch für das Vorkommen krautiger Pflanzen entscheidend ist.
Klimawandel und Naturschutz
Das Dolden-Winterlieb (Chimaphila umbellata) und der Blattlose Widerbart (Epipogium aphyllum) sind zwei Pflanzenarten, die sowohl geschützt als auch gefährdet sind. Sie kommen hauptsächlich in Nadelwäldern vor. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich dabei größtenteils auf bewirtschaftete Wälder. Durch den Klimawandel und den damit verbundenen Waldumbau hin zu laubholzreicheren Wäldern könnten diese Arten in Zukunft noch seltener werden. Des Weiteren beherbergt das Nadelholz ungefähr die Hälfte der Pilz- und Insektenarten das obwohl das Laubholz eine größere Anzahl an Baumarten aufweist. Das führt den Einfluss klimatischer Bedingungen auf das Vorkommen von Arten vor Augen.
Der Ansatz des konservierenden Naturschutzes, der bestimmte Arten auf einem festgelegten Standort fördert, könnte dadurch vor eine Herausforderung gestellt werden. Denn die heute vorkommenden Waldbestände könnten sich durch den Klimawandel verändern und damit könnten schützenswerte Arten, welche an das Vorkommen bestimmter Arten gebunden sind, künftig an anderen Standorten auftreten.
Waldbewirtschaftung erhält die Baumartenvielfalt
Durch die Waldbewirtschaftung kann die Baumartenvielfalt erhalten und das Vorhandensein unterschiedlicher Altersklassen gewährleistet werden. Zudem bieten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten von der Einzelstammnutzung bis hin zum Kahlschlag eine breite Maßnahmenpalette an, um den Lichteinfall im Bestand steuern zu können. Das ermöglicht eine verbesserte Baumartenvielfalt, die sich positiv auf das Vorkommen von xylobionten Käfern und Pilzen auswirkt. Denn diese Lebewesen profitieren von einer höheren Baumartenvielfalt.
Förderung des Artenschutzes durch Grundeigentümer:innen
Für den Artenschutz wäre es wichtig, wenn die Grundeigentümer:innen geschult und unterstützt würden, um seltene Arten zu erkennen. Denn die Grundeigentümer:innen wissen über die bisherige Art der Bewirtschaftung bestens Bescheid und können somit zum Artenschutz beitragen. Statt neue Verordnungen über die Bewirtschaftungsweisen zu erlassen, sollte das Wissen der Grundeigentümer:innen gefördert und genützt werden, um den Artenschutz effizient zu gestalten.
Projekte und Kurse für den Artenschutz im Wald
Der Autor betont, dass Waldbesitzer:innen gezielt geschult werden sollen, um seltene Arten im Wald zu identifizieren und deren Schutz sicherzustellen. Folgende Projekte/Kurse können genutzt werden, um Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen:
- Projekt BIMUWA: Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald stärken und unterstützen
Konkrete Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Arten spezifisch nach Tierart und Region in Österreich. - Onlinekurs: Biodiversität im Wald
Lernen sie in online was Biodiversität ist, welche Bedeutung sie hat und wie man sie fördert. - Biodiversiätsmonitoring biodiversitaetsmonitoring.at
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Verweise
- Projekt BIMUWA: Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald stärken und unterstützen
Konkrete Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Arten spezifisch nach Tierart und Region in Österreich. - Onlinekurs: Biodiversität im Wald
Lernen sie in online was Biodiversität ist, welche Bedeutung sie hat und wie man sie fördert. - Biodiversiätsmonitoring biodiversitaetsmonitoring.at
Quellen
- Zusammenfassung der Studie von DI Johannes Leeb
Quelle: Schulze, E. D., Weber, U. und Gebauer, G. (2024): Botanischer Artenschutz: Die Bedeutung des Waldes zum Erhalt der Artenvielfalt der Gefäßpflanzen in Deutschland. In: Naturschutz und Landschaftsplanung. Bd. 56, Heft 3. S. 34-38.(https://www.nul-online.de/themen/artenschutz-und-biotopverbund/article-7852900-201984/botanischer-artenschutz-.html)
Rechte & Produktion
© 2024 DI Johannes Leeb und waldgeschichten.com – Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich.
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.