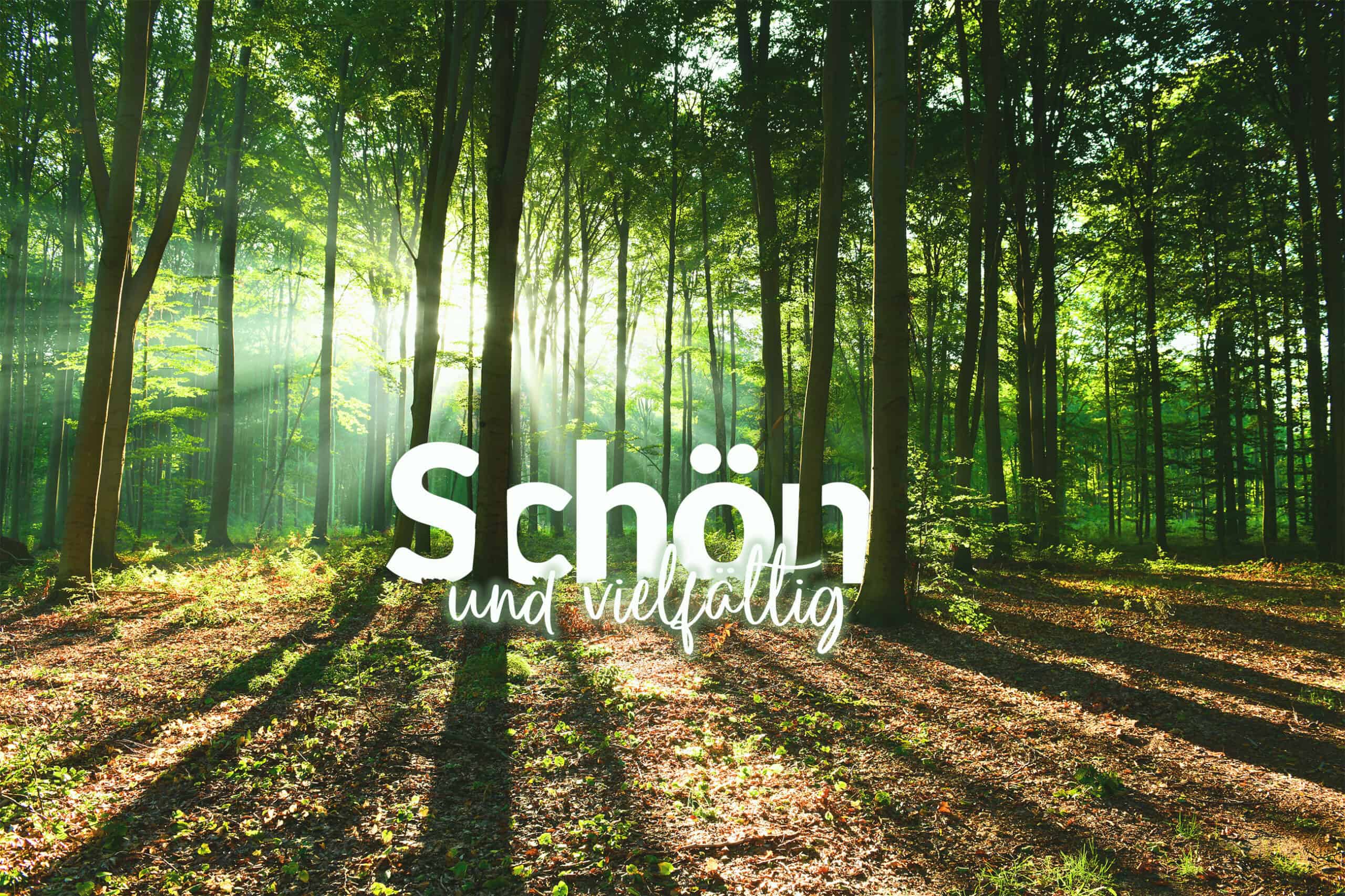© 2025 Adobe Stock, grafxart
Trittsteinbiotope und Habitatvernetzung
Wege zu mehr Artenvielfalt
Der Schutz und die Förderung der Biodiversität ist in Zeiten des Klimawandels – also jetzt und heute – entscheidend wie nie. Dies umfasst nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch Mikroorganismen, die in unseren Ökosystemen leben. Viele Arten wandern bereits in neue Gebiete und überwinden Barrieren, um Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen zu erhalten. Laut Wissenschaftlern wird diese Wanderung in Zukunft zunehmen. Doch nicht alle schaffen es: Zu sehr sind mögliche Lebensräume, z.B. durch Versiegelung der Landschaft, voneinander getrennt. Das Projekt Trittsteinbiotope setzt genau hier an.
Es vernetzt isolierte Lebensräume und erhöht so die Überlebenschancen für zahlreiche Arten, von Moosen bis hin zu Säugetieren. Diese österreichweite Initiative bringt Waldbesitzer und das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) zusammen, um geeignete Flächen auszuwählen und nachhaltig zu gestalten.
In den vergangenen Jahren wurden mehr als 400 Trittsteinbiotope in unterschiedlichsten Waldtypen und Landschaften geschaffen, insbesondere in den Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und Burgenland. Sie sind 10 bis 20 Jahre lang der Natur überlassen und nicht bewirtschaftet. Begleitet von wissenschaftlichen Untersuchungen tragen sie nicht nur zum Lebensraumgewinn für viele Arten bei, sondern bieten auch der Gesellschaft einen bedeutenden Gewinn: das Vernetzen von Lebensräumen als Schlüssel zur Bekämpfung des Artensterbens und damit der Erhaltung unseres lebenswichtigen Ökosystems.
Trittsteinbiotope
Trittsteinbiotope sind kleine Flächen, die entscheidend zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Sie dienen vielen Tieren und Pflanzen als Zufluchtsorte, ermöglichen vorübergehende Lebensräume und unterstützen die Fortpflanzung, insbesondere für Arten, die sich nur schwer bewegen können. Diese Biotope verbinden isolierte Lebensräume, fördern die Wanderung von Tieren und Pflanzen und helfen, ihre genetische Vielfalt zu erhalten.
Zu den Trittsteinbiotopen zählen beispielsweise einzelne Bäume, Baumgruppen, Hecken in der Landwirtschaft, Felsen, Steinhaufen und Gewässer. Durch ihre gezielte Anlage stärken sie nicht nur die Ausbreitungsmöglichkeiten der Arten, sondern auch die Widerstandsfähigkeit der gesamten Natur, was entscheidend für den Erhalt der Artenvielfalt und den Schutz unserer Wälder ist.
Projekt Trittsteinbiotope des BFW
Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) fungiert als österreichische Forschungs- und Bildungseinrichtung des Bundes. Es trägt zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft bei, indem es wissenschaftliche Grundlagen erstellt und Wissen über die vielfältige Nutzung natürlicher Ressourcen vermittelt, wobei ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt werden.
Internationale Initiativen
Mit der von den Vereinten Nationen ausgerufenen Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen (2021–2030) sowie der verabschiedeten EU-Renaturierungsverordnung wird diesem Thema international höchste Priorität eingeräumt. Ziel ist es, die ökologische Konnektivität – den ungehinderten Austausch von Arten und natürlichen Prozessen – zu sichern. Diese Konnektivität bildet die Grundlage für das Überleben zahlreicher Lebensformen und die Stabilität unserer Ökosysteme.
Ein Beispiel für solche Initiativen ist das Pilotprojekt „ConnectForestBiodiversity“ (ConnectForBio), das einen bedeutenden Beitrag zur Identifikation, Bewertung und Vernetzung von Trittsteinbiotopen in österreichischen Wäldern leistet.
© 2025 Adobe Stock, mRGB
Trittsteinbiotope – das ganze Ökosystem im Fokus
Zum Erhalt der österreichischen Wälder liegt der Fokus längst nicht mehr ausschließlich auf dem Wald selbst, sondern auf dem gesamten Ökosystem und dessen komplexen Wechselwirkungen, Funktionen und Leistungen. Etwa die Hälfte der Fläche Österreichs ist bewaldet, was die immense Bedeutung der Wälder für die biologische Vielfalt unterstreicht. Diese Wälder bieten über 50 % der Tier- und Pflanzenarten des Landes einen geeigneten Lebensraum und sind damit das bedeutendste Habitat der österreichischen Natur. Die Vielfalt in diesen Wäldern hängt nicht nur von den unterschiedlichen Standortbedingungen ab, sondern auch von einer nachhaltigen, kleinräumigen und mosaikartigen Bewirtschaftung durch die Waldeigentümer.
Erhalt der Biodiversität
Um die Biodiversität in unseren Wäldern zu erhalten und zu fördern, sind zwei zentrale Aspekte von entscheidender Bedeutung. Der erste Baustein ist das Erhalten und Fördern der Biodiversität durch gezielte Maßnahmen im Rahmen einer klimafitten und multifunktionalen Waldbewirtschaftung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem:
- Belassen von Totholz –Totholz bietet zahlreichen Organismen Lebensraum und ist essenziell für den Nährstoffkreislauf im Wald.
- Schutz von Habitat- und Veteranenbäumen – Diese Bäume sind oft Heimat für viele Arten und tragen zur Stabilität des Ökosystems bei.
- Gestaltung von Waldrändern – Eine vielfältige Struktur an Waldrändern fördert die Artenvielfalt und schafft Übergangszonen zu anderen Lebensräumen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Außernutzungsstellung ausgewählter Flächen. Diese Flächen fördern die Verbindung isolierter Lebensräume und unterstützen damit die Ausbreitung von Arten.
© 2025 Adobe Stock, leopold
© 2025 Adobe Stock, taviphoto
Habitat-Vernetzung für die Wald-Biodiversität
Die Habitat-Vernetzung ist nun ein zweiter entscheidender Baustein für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität und wird im Rahmen des Trittsteinbiotop-Programms vorangetrieben. Dieser Ansatz fördert nicht nur die Vernetzung von Lebensräumen, sondern bezieht auch den Vertragsnaturschutz mit ein. Darunter versteht man eine Strategie der Naturschutzbehörden, die Wälder und deren Lebensräume für Tiere und Pflanzen im freiwilligen Zusammenwirken von Grundstücksbesitzern zu erhalten – für einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg im angewandten Naturschutz.
Zusammenspiel aus Wissenschaft und Praxis
Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis spielt eine zentrale Rolle, da sie wertvolle Informationen über die Entwicklung der Waldbiodiversität liefert. Das BFW als langjähriger Partner der forstlichen Praxis sorgt für eine wissenschaftliche Begleitung auf höchstem und vertrauenswürdigem Niveau. Letztendlich ist es die Kombination aus Vertragsnaturschutz und kompetenter Flächenbetreuung, die den Erfolg des Trittsteinbiotope-Programms ausmacht. Dies spiegelt sich in den zahlreichen freiwillig zur Verfügung gestellten Waldflächen wider.
Innovative Methoden und Datenerhebung
Das Projekt hat nicht nur innovative Methoden zur Priorisierung von Trittsteinbiotopen entwickelt, sondern auch wegweisende Datenerhebungsprotokolle etabliert. Diese Protokolle berücksichtigen verschiedene Biodiversitätsaspekte, wie die Vielfalt der Vegetation, Pilze, Käfer, Vögel und Fledermäuse sowie die Boden-Biodiversität. So konnten mehr als 400 Trittsteinbiotope in unterschiedlichen Waldtypen und Landschaften identifiziert und vernetzt werden.
Dieses beeindruckende Netzwerk ermöglicht es uns, bedeutende Fragen zur Biodiversität zu beantworten, etwa die vergleichende Beobachtung von Biodiversitätsentwicklungen in bewirtschafteten und nicht bewirtschafteten Wäldern. So sind auch die kontinuierliche Forschung und Überwachung sind entscheidend, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität zu verstehen und geeignete Anpassungsstrategien zu entwickeln.
© 2025 Adobe Stock, Maria
© 2025 Adobe Stock, Loes Kieboom
Trittsteinbiotope – mögliche Flächen
Waldflächen mit Habitatbäumen
Habitatbäume, die entweder lebendig oder abgestorben sind, bieten besondere Mikrohabitate. Solche Mikrohabitate, etwa Baumhöhlen oder Moose, schaffen wertvolle Rückzugsorte für viele Arten. Die Anwesenheit von mindestens fünf Habitatbäumen pro Hektar qualifiziert eine Waldfläche als Trittsteinbiotop.
Totholzreiche Flächen
Die Menge an Totholz ist entscheidend für die Biodiversität und Naturnähe eines Waldes. Dabei spielen sowohl die Quantität als auch die Beschaffenheit von Totholz eine wesentliche Rolle. Waldflächen mit einer Mindestmenge von 20 m³ Totholz pro Hektar können ebenfalls als Trittsteinbiotope eingerichtet werden.
Sonderstandorte
Sonderstandorte sind Bereiche, deren Eigenschaften stark von den vorherrschenden Bedingungen abweichen und die spezialisierten, oft seltenen Arten Lebensraum bieten. Diese Flächen sind essenziell, um Populationen an den Rändern ihrer Verbreitung in klimatisch geeignete Bereiche auszubreiten. Wenn mehr als 50 % dieser Klassifizierung entsprechen, können Sonderstandorte als Trittsteinbiotope ausgewiesen werden.
Flächen mit Habitatstrukturen
Habitatstrukturen sind Kleinlebensräume am Waldboden, die zur Strukturvielfalt eines Waldes beitragen. Sie fördern die Artenvielfalt und unterstützen die Erhaltung der genetischen Vielfalt. Dazu gehören unter anderem Wurzelteller, die durch umgestürzte Bäume entstehen, und andere spezifische Lebensräume wie Feucht- und Trockenbiotope.
Flächen mit seltenen Artenvorkommen
Flächen mit gefährdeten Arten, die gemäß der Roten Liste als mindestens „gefährdet“ eingestuft sind, können als Trittsteinbiotope ausgewiesen werden. Der gezielte Schutz solcher Flächen und die Vernetzung von Lebensräumen erhöhen die Chancen, dass Arten sich durch die Landschaft bewegen und neue Lebensräume besiedeln.
Flächen natürlicher Sukzession
Sukzessionsflächen sind Waldflächen, die nach Störungen entstehen und wertvolle Einblicke in die natürliche Wiederbewaldung bieten. Die Untersuchung dieser Flächen ermöglicht es, Prozesse der Samenverbreitung nachzuvollziehen und die Auswirkungen von Klimawandel und Schädlingen zu analysieren.
Flächensuche und Flächenmeldung
Die Suche nach geeigneten Waldflächen erfolgt über Aufrufe zur freiwilligen Flächenmeldung auf der Website www.trittsteinbiotope.at. Unterstützt von Projektpartnern wie BIOSA wird die Flächenakquise durch verschiedene Kommunikationskanäle intensiv publik gemacht. Um eine ausgewogene Verteilung in allen Bundesländern sicherzustellen, wird die Flächenakquise gezielt in den entsprechenden Regionen intensiviert.
Trittsteinelemente im Wald auswählen
Trittsteinelemente im Wald umfassen geeignete Flächen sowie Einzelbäume und Baumgruppen. Diese müssen der natürlichen Entwicklung überlassen werden, um eine naturnahe Bewirtschaftung zu gewährleisten. Bei der Auswahl der Flächen sind sowohl die naturschutzfachlichen Gegebenheiten als auch die Erfordernisse der Waldbewirtschaftung zu berücksichtigen. Wird eine Waldfläche als geeignet eingestuft, erfolgt die Flächenabgrenzung gemeinsam mit den Waldeigentümern. Das Entscheidende ist, Trittsteinbiotope klar von bewirtschafteten Flächen zu differenzieren. Die Markierung erfolgt durch das Setzen von Zeichen am Baumbestand und das digitale Erfassen der Grenzen.
© 2025 Adobe Stock, schusterbauer
Zum Weiterlesen
Zum Nachlesen
Quellen
- Bundeforschungszentrum für Wald – BFW
- Quelle: Naturschutz – Rund ein Drittel der Waldfläche Österreichs unter Schutz
Rechte & Produktion
© 2022 BFW und waldgeschichten.com – Die österreichischen Familienwaldbetriebe & Österreichischer Forstverein – Unterstützt durch den Holzinformationsfonds der Landwirtschaftskammer Österreich
Redaktion
Wir haben sorgfältig recherchiert und Informationen zusammengetragen. Wenn ihnen dennoch etwas auffällt, was sie ändern würden oder etwas zu ergänzen wäre, bitten wir sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen uns über ihre Rückmeldung und Anregungen.